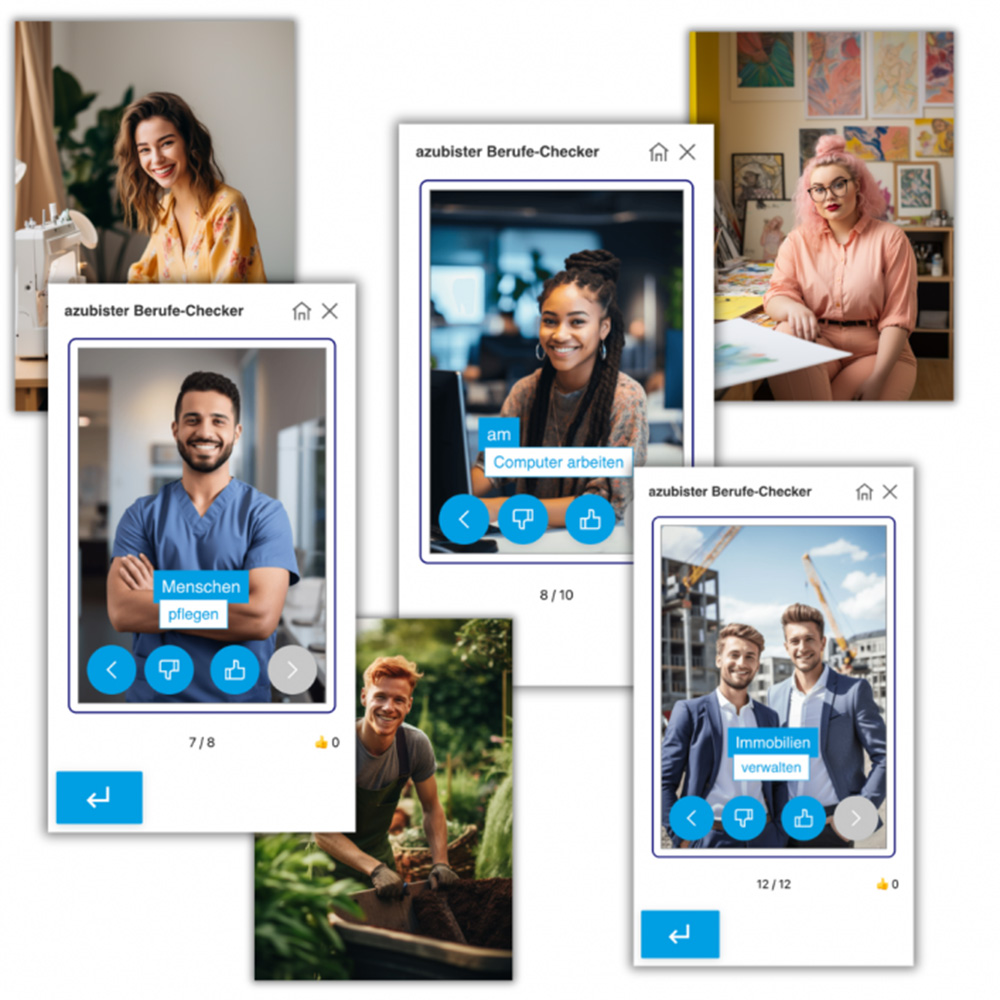Lesen Sie bei evidero den Prolog aus dem Buch “Vom Gärtnern in der Stadt – die neue Landlust zwischen Beton und Asphalt” von Martin Rasper.
Ein Gespenst geht um in Europa, ein fröhliches buntes Gespenst mit Dreck unter den Fingernägeln: der Neue Gärtner. Aufgetaucht aus dem Nichts, hat er in kürzester Zeit die Städte erobert. Die Illustrierten überschlagen sich mit Geschichten über coole Guerilla-Gärtner und urbane Gemüsezüchter. Designer entwerfen futuristische Hängebeetkonstruktionen und Gartengeräte aus Recyclingmaterial. Gärtnern ist hip, ist „der neue Rock ’n‘ Roll“, wenn nicht gar, wie aus London zu hören war, „der neue Sex“.
Die Musikzeitschrift Spex nennt die Gründer des Berliner Prinzessinnengartens „Die Bauern von Kreuzberg“ und zeigt einen der beiden auf einem historisierenden Schwarz-Weiß-Foto mit Zigarette im Mundwinkel und Tweedmütze auf dem Kopf, wie er lässig mit der Brause die Hochbeete wässert, eine skurrile Mischung aus James Dean und Henry David Thoreau.
Was ist da passiert? Urbanes Gärtnern ist doch ein Widerspruch in sich, sollte man meinen. Waren die Städte nicht immer ein Synonym für Naturferne, oder jedenfalls für eine Lebensweise, in der ganz andere Koordinaten zählten? Steingewordene Geschichte, geballtes Leben, Kino, Kneipe, Kultur einerseits; aber auch Verkehrschaos, Menschenmassen, schlechte Luft – für diesen Teil des Großstadtbildes stand lange „Die Unwirtlichkeit unserer Städte“, Alexander Mitscherlichs Abrechnung mit dem naiv-bornierten Aufbruchsgeist der Wirtschaftswunderzeit, als geradezu sprichwörtlich.
Stadt im Wandel? – „Cities will just vanish“
 Anfang der neunziger Jahre lebte ich eine Zeitlang in einer Aussteiger-Kommune im Regenwald von Costa Rica. Wir bauten Ananas und Bananen an, pflegten Brotfrucht-, Mango- und Kakaobäume, backten unsere Brotfladen am offenen Feuer und liefen einmal die Woche ins acht Kilometer entfernte Städtchen, um Reis, Öl und die einzige verfügbare Zeitung zu kaufen.
Anfang der neunziger Jahre lebte ich eine Zeitlang in einer Aussteiger-Kommune im Regenwald von Costa Rica. Wir bauten Ananas und Bananen an, pflegten Brotfrucht-, Mango- und Kakaobäume, backten unsere Brotfladen am offenen Feuer und liefen einmal die Woche ins acht Kilometer entfernte Städtchen, um Reis, Öl und die einzige verfügbare Zeitung zu kaufen.
Alle dort waren mehr oder weniger davon überzeugt, dass die überdrehte Zivilisation, aus der wir kamen, keine Zukunft haben würde. Stattdessen würde es künftig darum gehen, irgendwo auf dem Land sich selbst zu versorgen, möglichst wenig Energie und Rohstoffe zu verbrauchen und überhaupt mit der Welt sorgsam umzugehen. Wie aber würde die aussehen? Und was würde mit den Städten geschehen, aus denen die meisten von uns stammten? „Cities“, dozierte da ein rauschebärtiger, in der Wolle gefärbter kalifornischer Hippie, der sich Sun Dog nannte – „cities will just vanish“. Die Städte werden einfach verschwinden. Es war keine Meinung, sondern eine Feststellung.
Und die war seinerzeit durchaus populär. Der amerikanische Historiker Mike Davis hatte gerade sein Traktat City of Fear veröffentlicht, in dem er wortreich den Untergang von Los Angeles an die Wand malte; und wie um ihn zu bestätigen, waren kurz darauf in der Stadt heftige Rassenunruhen ausgebrochen.
Auch Sun Dog wusste, wovon er sprach, er stammte aus San Diego, er kannte zwölfspurige Freeways und den Smog und das Gefühl, mit leerem Tank in einer feindlichen Gegend zu stranden. „Die Städte werden an ihrer eigenen Scheiße ersticken“, prophezeite er, „an ihrem Müll, ihrem Verkehr, ihren Abgasen, ihrer Gewalt. Sie werden sich in einem logistischen, sozialen, infrastrukturellen Chaos einfach auflösen.“ Und wann so? Irgendwann nach dem Jahr 2000. Und das schien damals noch ziemlich weit weg zu sein.
Mosaik von Stilen und Durchlauferhitzer für Ideen
Es kam bekanntlich anders. Städte sind lebendiger als je zuvor. Seit dem Jahr 2008 leben nach offizieller Schätzung der Vereinten Nationen mehr als die Hälfte der Menschheit in Städten – erstmals überhaupt in der Geschichte. Eine Marke, die sich als ähnliche Zäsur erweisen könnte wie die Erfindung der Stadt selbst, im Lauf der Neolithischen Revolution.
Städte sind attraktiv, und sei es aus purer Not. Und so sehr sich Orte wie München oder Warschau von den wuchernden Megacities in Afrika und Asien unterscheiden, haben sie doch vieles gemeinsam: die grundsätzlichen Unterschiede nämlich zwischen Stadt und Land. Eine Stadt hat gegenüber ihrer Umgebung einen vielfach erhöhten Energie- und Materialumsatz; sie ist Ausgangs- und Zielpunkt von Verkehrs-, Kommunikations- und Warenströmen.
Sie bildet ein kleinräumiges Mosaik von Lebensstilen, Denkstilen, Baustilen, Flächennutzungsstilen; sie dient als Durchlauferhitzer für Ideen und als Beschleuniger von Biografien. Eine Stadt ist verdichtetes Leben.
 Derweil werden viele Städte, zumindest in den Industrieländern, immer lebenswerter. Die Unwirtlichkeit dagegen, die Mitscherlich noch so wortreich beklagte, wandert zunehmend in die globalisierten Strukturen aus. Sie wird dabei abstrakter und unschärfer, bleibt aber nichtsdestoweniger real. Nicht von ungefähr fällt das beschleunigte Wachstum der Städte mit fortschreitender Globalisierung zusammen.
Derweil werden viele Städte, zumindest in den Industrieländern, immer lebenswerter. Die Unwirtlichkeit dagegen, die Mitscherlich noch so wortreich beklagte, wandert zunehmend in die globalisierten Strukturen aus. Sie wird dabei abstrakter und unschärfer, bleibt aber nichtsdestoweniger real. Nicht von ungefähr fällt das beschleunigte Wachstum der Städte mit fortschreitender Globalisierung zusammen.
Die Welt wird immer arbeitsteiliger, und vielen Weltgegenden sieht man das bereits an. Die andalusische Küste zum Beispiel wurde in den vergangenen Jahren in ein einziges Plastikgewächshaus verwandelt, in dem billige Erdbeeren und Rosen, Tomaten und Gurken für den europäischen Markt produziert werden. Und in ganzen Landstrichen der USA, Brasiliens und Argentiniens wächst praktisch nichts mehr außer künstlich bewässerten, künstlich ernährten, künstlich gegen Schädlinge immunisierten Mais-, Kartoffel-, Soja- und Baumwollpflanzen.
Die größten Konzerne machen längst Umsätze wie mittlere Länder. WalMart, Royal Dutch Shell und ExxonMobile setzen in guten Jahren jeder für sich mehr Geld um als Österreich oder Norwegen. Und eine geradezu dramatische Machtkonzentration findet bei Konzernen wie Monsanto oder Syngenta statt, die dabei sind, die weltweite Kontrolle über das Saatgut und die Sortenvielfalt der Nutzpflanzen zu erlangen, also über Ressourcen, die für die Menschheit lebenswichtig sind.
Irre Beschleunigung
Viele Menschen fühlen sich damit zunehmend unwohl. Unwohl angesichts der Art und Weise, wie Ressourcen verbraucht und Lebensmittel produziert werden; unwohl angesichts der irren Beschleunigung, die der Warenumsatz genommen hat; unwohl auch damit, wie arbeitsteilig selbst der banale Alltag geworden ist. Man kann seinen Wecker nicht mehr reparieren, weil er nur noch aus einem Chip und ein paar verschweißten Plastikteilen besteht, die Warenströme rauschen an uns vorbei, dass uns Hören und Sehen vergeht, und wir machen uns automatisch schuldig, wenn wir ein billiges T-Shirt kaufen.
Von diesem Unwohlsein handelt dieses Buch – und von einem Ansatz, es zu überwinden. Immer mehr Menschen fordern wieder eine Teilhabe an diesen Prozessen ein; nicht nur in den Städten, aber vor allem dort. Ihnen dämmert, dass die Monokulturen auf dem Acker und in den Industriehallen ein Gegenstück besitzen – in Form einer Leerstelle, die in unserem Alltag entstanden ist. Sie fühlen sich abgeschnitten vom Produktionskreislauf der Lebensmittel, vom Säen und Ernten, Vorsorgen und Selbermachen, von den meisten der jahrhundertelang eingeübten Kulturtechniken, die damit verbunden waren. Abgeschnitten auch von der Beziehung zu dem Produzenten, der mit seiner Person noch für sein Produkt einsteht.
Kein Zurück in die Steinzeit
 Und weil das viele Menschen so empfinden, passieren unterschiedliche Dinge. Am spektakulärsten sind natürlich die urbanen Gartenprojekte wie der Prinzessinnengarten in Berlin, der viele Menschen inspiriert und zur Nachahmung angeregt hat. Weniger überraschend, aber viel weiter verbreitet sind die Selbsternteprojekte, die zurzeit überall in Deutschland entstehen und in denen man ohne Vorkenntnisse eine Saison lang eigenes Gemüse ziehen kann.
Und weil das viele Menschen so empfinden, passieren unterschiedliche Dinge. Am spektakulärsten sind natürlich die urbanen Gartenprojekte wie der Prinzessinnengarten in Berlin, der viele Menschen inspiriert und zur Nachahmung angeregt hat. Weniger überraschend, aber viel weiter verbreitet sind die Selbsternteprojekte, die zurzeit überall in Deutschland entstehen und in denen man ohne Vorkenntnisse eine Saison lang eigenes Gemüse ziehen kann.
Anderswo pachten Menschen gemeinsam ein Stück Land vor der Stadt und bestellen es für den Eigenanbau; andere beteiligen sich an Bauernhöfen, denen sie damit eine finanzielle Grundversorgung garantieren, und werden so zu Kunden, Investoren und Verbündeten zugleich. Und das erste Handelsunternehmen ermuntert bereits seine Kunden, das Gemüse selbst anzubauen, das es ihnen doch eigentlich verkaufen sollte – ein deutliches Zeichen, dass die herkömmliche kaufmännische Logik an Grenzen gestoßen ist und dass es an der Zeit ist, neue Wege auszuprobieren.
Bei alldem geht es nicht um ein Zurück zur Natur oder zur Steinzeit oder sonst wohin. Was ansteht, ist eine Neuorientierung und Neubewertung, ein neuer Zugang zu Wissen und Erfahrung. Die Auseinandersetzung mit den natürlichen Grundlagen unserer Existenz, vor allem auch damit, wie diese wirtschaftlich und gesellschaftlich organisiert werden, ist Ausdruck einer – durchaus politischen – Haltung. Gärtnern war immer eher konservativ; dass es nun auch subversive Aspekte bekommt, ist neu.
Stadt und Land – kein Gegensatz, sondern ein Verhältnis der Ergänzungen
Sicher: Der direkte Beitrag, den die Städte tatsächlich zur Versorgung mit Lebensmitteln leisten können, wird immer gering bleiben. Wer Selbstversorgung anstrebt, braucht Platz, der in unseren Städten in der Regel nicht vorhanden ist. Und gegen die Dimension, in der die Gentechnik- und Saatgutkonzerne ganze Landstriche besetzen, sind die zerstreuten Gärten ohnehin ein Klacks.
Aber die Größenordnung ist nur ein Aspekt der Sache. Es geht um Bewusstseinsveränderung, es geht auch schlicht ums Tun. Ums Ausprobieren, ums Erfinden neuer Formen und Konzepte, auch um die Wiederentdeckung bewährter Methoden. Ich wage die Voraussage, dass das urbane Gärtnern unsere Städte verändern wird, und nicht nur sie. Die Erfahrungen, die hier gemacht werden, die Kompetenzen, die erworben werden, die neuen Formen, die hier entstehen, werden zurückwirken aufs Land.
Das Verhältnis zwischen Stadt und Land wird neu definiert, es wird vielfältiger, differenzierter. Stadt-Land, das ist nicht mehr unbedingt ein Gegensatz, es entwickelt sich zunehmend zu einem Verhältnis der Ergänzung, der wechselseitigen Beziehungen.
Von Sun Dog, dem Hippie aus dem Regenwald, hörte ich noch einmal zehn Jahre später – indirekt, per Mail, über einen Freund, der ihn besucht hatte. Er war wieder in Kalifornien gelandet, auf einer „Permakultur“-Farm (damals hörte ich das Wort zum ersten Mal) in Mendocino County, „mitten im Busch“, wie es hieß, also im Wald. Dicker sei er geworden, dafür der Bart kürzer, das Mundwerk aber tadellos. Noch bringe das Projekt nicht viel ein, hieß es, „direkte Kunden“ gebe es noch nicht, aber „Interesse“. Von Leuten aus Ukiah, aus Santa Rosa, bis runter Richtung San Francisco. Von Leuten aus den Städten.
Gärten als Retter der Welt
In den Städten sitzen die Menschen, die über die Zukunft unseres Planeten entscheiden. Einfach deshalb, weil sie die Mehrheit sind. Die größten Herausforderungen, vor der wir stehen, betreffen den Umgang mit den natürlichen Ressourcen: Luft, Wasser, Boden, Nahrung.
Und Gärtnern ist genau das – ein Spiel mit Ressourcen. Mit Saatgut, Erde, Dünger, Licht; mit Pflanzenarten und -sorten; mit pflanzlichen und tierischen Helfern; mit Lebenszeit, mit persönlicher Energie und dem zur Verfügung stehenden Raum.
Gärtnern bedeutet Hoffen und Warten, Freude und Enttäuschung. Geduldig sein, ungeduldig sein. Fehler machen, aus Fehlern lernen. Mit echten Pflanzen arbeiten, echter Erde, echten Früchten, echten Schädlinge. Gärtnern bedeutet, Grenzen zu erkennen, die eigenen wie die der Natur. Gärten gibt es seit mehr als zehntausend Jahren, in allen Kulturen.
Noch nie aber traten Gärten in einer solchen Vielfalt von Formen und Funktionen auf wie heute. Die Gärten erleben im Moment eine ziemlich spannende Phase ihrer Entwicklung.
Der amerikanische Autor Michael Pollan hat in seinem Buch „Die Botanik der Begierde“ einen hübschen Gedanken entwickelt: Wie wäre es denn, fragt Pollan, wenn wir die herkömmliche Sichtweise einmal umdrehten? Der Mensch baut Apfelbäume an, weil sie ihm nützen, und züchtet immer neue Sorten, okay. Aber andererseits, und das ist jetzt die umgekehrte Sichtweise, benutzt der Apfelbaum auch den Menschen: indem er nämlich dessen Bedürfnis nach Äpfeln erfüllt, um sich und seine Gene fortzupflanzen. Und auf diese Weise haben sich nur wenige Pflanzen derart flächendeckend über die Erde ausgebreitet wie der Apfelbaum.
Auf die Gärten übertragen, bedeutete diese Sicht: Möglicherweise haben die was vor. In einem krisenhaften Augenblick ihrer Geschichte (und der Menschheit!) erklimmen die Gärten eine neue Evolutionsstufe. Innerhalb kürzester Zeit entwickeln sie vielfältige neue Formen, und sie nutzen die Krise, um sich stärker zu verbreiten als je zuvor. Auch auf die Gefahr hin, dass es etwas schräg klingt: Vielleicht haben die Gärten sich ja vorgenommen, die Welt zu retten. Wir sollten sie dabei unterstützen.