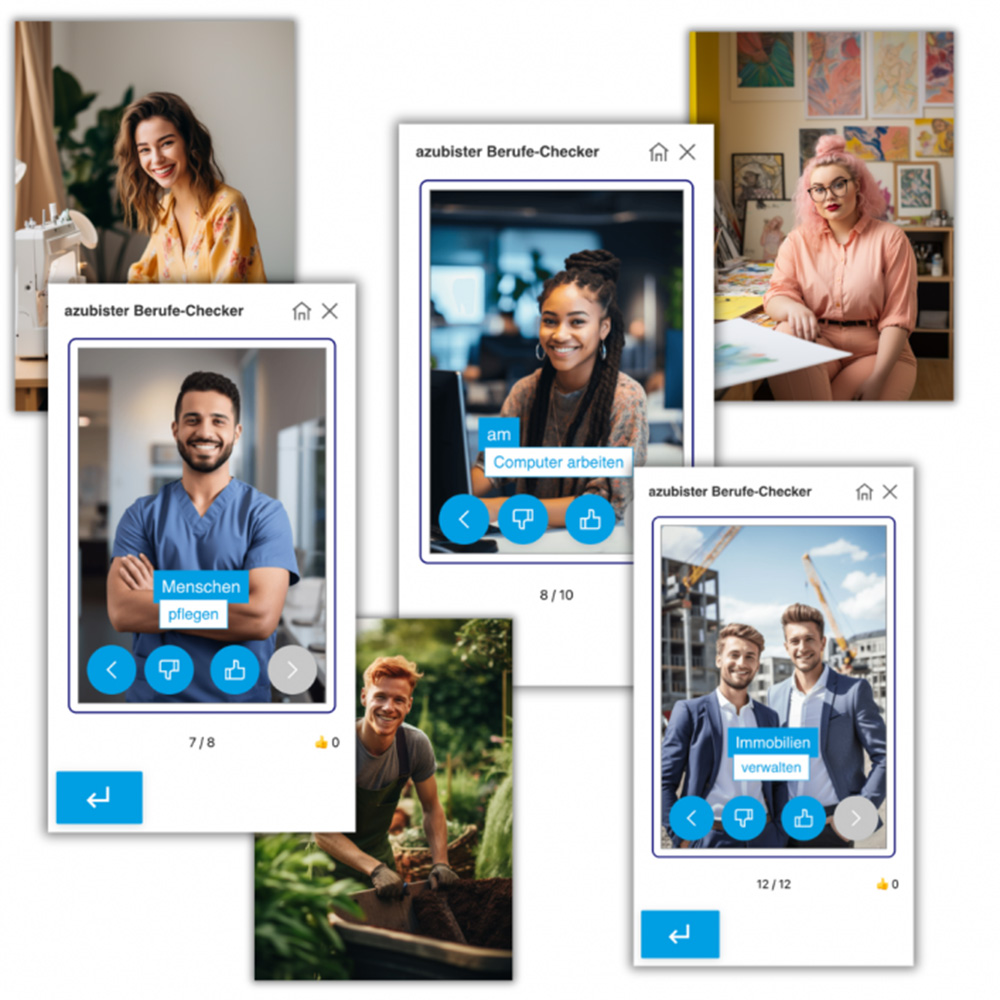Der Web-TV Themenschwerpunkt mit Filmen von David Vehreschild. Unser Autor, selbst überzeugter Gartenaktivist, unternimmt eine kritische Würdigung. Das wild wuchernde Treiben hat viele Namen und viele neue Fans: Urban Gardening, Gemeinschaftsgärten – selbst der Schrebergarten hat in den letzten Jahren sein Spießerimage abgelegt und ist salonfähig geworden. Was ist da los?
Berlin, so geht das Klischee, ist multikulti, Anarchie, Widerstand – ist wildes, ungeplantes Wachstum. Insofern gibt es im Moment vielleicht kein typischeres Stück Berlin als den Allmende-Garten auf dem Gelände des ehemaligen Flughafen Tempelhof. Als Zwischennutzung bis 2016 darf das Allmende-Kontor eine 5000 Quadratmeter große Fläche für einen Nachbarschaftsgarten nutzen.
Und die Leute aus dem Kiez nehmen das Angebot begeistert an. Gegärtnert wird in Hochbeeten, die auf abenteuerliche Weise aus Holzresten zusammengezimmert sind; der unmittelbare Boden ist wegen der jahrzehntelangen Vergangenheit als Flughafen zu heikel. Viele, die hier zugange sind, hatten vorher keine Gartenerfahrung; sie legen einfach los, mit viel Enthusiasmus und Fantasie.
Es geht primär ums Pflanzen, Säen, Ernten; um Selbstversorgung, um frisches gesundes Gemüse. Aber nicht nur. Es geht auch darum, etwas Sinnvolles zu tun, gemeinsam mit anderen und nicht zuletzt für einen selbst. Es geht darum, wieder teilzuhaben am Prozess der Lebensmittelerzeugung, denn der Mainstream geht trotz Öko-Boom und trotz aller Appelle zum regionalen Wirtschaften immer weiter Richtung Globalisierung und Industrialisierung.
Die Menschen wollen wieder selbst anbauen
„Die Leute fühlen sich zunehmend abgeschnitten vom Produktionskreislauf der Lebensmittel“, urteilen die Soziologen Daniel Dahm und Gerhard Scherhorn. Produkte wie Klebefleisch oder Analogkäse, der kein Käse ist, und die immer dreisteren Lügen auf den Verpackungen schärfen das Bewusstsein dafür, wie sehr sich die Food-Industrie von den Bedürfnissen vieler Menschen entfernt hat. „Zu lernen, wie Gemüse wächst und gezogen wird, heißt anfangen, die Codes der Lebensmittelindustrie zu knacken“, schrieb die Süddeutsche Zeitung am 22.10.2011.
Für Christa Müller, Geschäftsführerin der Stiftung-Interkultur, die viele Gartenprojekte unterstützt, ist das keine Bewegung zurück zu irgendetwas – sondern eine sehr zeitgemäße, die einen echten Ausweg weisen kann. „Modernität bedeutete ja bisher immer, dass man sich nicht selbst versorgen muss“, sagt Christa Müller, „sondern, dass man das delegiert. An die Bauern, an die Supermärkte, an die Lebensmittelindustrie. Und das hat ja auch eine Weile ganz gut geklappt. Aber jetzt spüren immer mehr Menschen, dass es so nicht weitergeht.“
Trotzdem stoßen die Stadtgärtner häufig auf Skepsis oder Argwohn. Vielen Zeitgenossen erscheint das Urban Gardening wie ein überdrehter Zeitvertreib neurotischer Stadtmenschen und überdies als gar nichts Neues. Wir haben die wichtigsten Kritikpunkte untersucht.
1. Was soll daran neu sein? Gärten in der Stadt gab es doch schon immer
Stimmt; wobei selbst der „normale“ Gemüseanbau im Hausgarten seit den siebziger Jahren stark nachgelassen hat. Neu aber ist jetzt die Vielzahl und Bandbreite der Gartenformen: Selbsterntegärten, Gemeinschaftsgärten, Nachbarschaftsgärten, mobile Gärten in Hochbeeten und Kisten.
Neu ist vor allem auch das soziale Element, das alle urbanen Garteninitiativen betonen. Es geht ums gemeinsame Tun; es geht auch ums Lernen, um die Vermittlung von Wissen, um das Schaffen von Bewusstsein. „Der Sinn unserer urbanen Landwirtschaft ist es, Leute zusammen zu bringen, Kooperationen und Austausch herzustellen, der in dieser Art im städtischen Raum eher selten ist“, sagt Marco Clausen vom Berliner Prinzessinnengarten. „In unseren Gärten wird gemeinsam ein Raum hergestellt.“
2. Urban Gardening ist eine Mode, die schon bald wieder abflauen wird
 evidero
evideroIm Gegenteil: Alle Indizien weisen darauf hin, dass es sich um eine nachhaltige Bewegung handelt. Ein erstes Anzeichen war vor einigen Jahren die Entwicklung, dass Schrebergärten plötzlich nicht mehr als spießig galten, sondern zunehmend auch von jungen Leuten nachgefragt wurden.
Dazu kamen die Internationalen oder Interkulturellen Gärten zur Förderung der Integration, durch gemeinsames Gärtnern von Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Es gibt sie bereits seit 1995 und ihre Zahl wächst stetig; derzeit sind es rund 120, dazu mehrere Dutzend in Planung. Ebenfalls stark im Wachsen begriffen – und noch relevanter für das Thema – ist das Modell der Selbsterntegärten, die besonders für Anfänger geeignet sind.
Bezeichnend ist auch die wachsende Zahl der Urban-Gardening-Initiativen: Die Prinzessinnengärten in Berlin-Kreuzberg haben sich längst zu einem Anziehungspunkt des Viertels und darüber hinaus entwickelt; ähnliche Initiativen gibt es in vielen Städten. Schließlich ist Gärtnern Nachhaltigkeit an sich. „Wer einen Garten anlegt, übernimmt Verantwortung“, sagt Claudia Plöchinger vom Hamburger Gartendeck, „zum einen natürlich für die Pflanzen – das sind ja Lebewesen – aber auch für die Menschen, die in den Garten kommen und das auch weiterhin tun wollen.“
3. Eine Stadt kann sich niemals komplett selbst versorgen
Stimmt. Behauptet auch niemand. Aber jedes Stück Gemüse, das in der Stadt angebaut wird, verbessert ihre CO2-Bilanz und spart Energie, die sonst für Erzeugung und Transport aufgewendet worden wäre. Außerdem ist ein Selbstversorgungsgrad von einigen Prozent, wie er selbst für größere Städte in unseren Breiten erreichbar ist, durchaus relevant; dazu kommen weitere Prozente, wenn das unmittelbare Umland nicht für den Weltmarkt produziert, sondern konsequenter die eigene Stadt versorgt.
Und kleinere, locker bebaute oder sonstwie begünstigte Städte können leicht einen höheren Autarkiegrad erreichen. In den Entwicklungsländern, zumal in wärmerem Klima, gelten noch mal ganz andere Maßstäbe, vor allem dann, wenn sie in günstigen Klimazonen liegen. Paradebeispiel ist Havanna, das sich (wenn auch aus der Not geboren) mit Obst und Gemüse überwiegend selbst versorgt; aber auch in Städten wie Lagos, Nairobi, Accra oder Hanoi erzeugen die Stadtbewohner einen erklecklichen Teil selbst.
Die Einsicht, dass die Städte alles in ihrer Macht Stehende tun müssen, um mehr produktives Grün zu schaffen, setzt sich zunehmend auch bei europäischen Politikern und Stadtplanern durch. London hat vor einigen Jahren ein ehrgeiziges Programm begonnen, genannt „Capital Growth“. Mit Blick auf die Olympischen Spiele hat die Stadt sich vorgenommen, bis Ende des Jahres 2012 auf ungenutzten und „untergenutzten“ Flächen innerhalb des Stadtgebiets die Zahl von 2012 neuen Gärten zu erreichen, damit die Bürger wieder einen direkten Zugang zum Thema Lebensmittel bekommen.
Die Stadt gibt den Anstoß und die finanzielle Unterstützung; aktiv werden müssen die Bürger selber. Bis zum Jahreswechsel 2011/2012 sind 1464 neue Gartenflächen geschaffen worden; das Programm gilt bereits jetzt als gelungen.
4. Die Städte sind viel zu dreckig, um dort gesundes Obst und Gemüse anzubauen
 ©Heike Brückner/Stiftung Bauhaus Dessau
©Heike Brückner/Stiftung Bauhaus DessauStimmt nicht. Mit einer Ausnahme: Wo der Boden kontaminiert ist, etwa mit Altöl, Schwermetallen oder giftigen Kohlenwasserstoffverbindungen (oder wo ein begründeter Verdacht besteht), sollte man tatsächlich nicht direkt im Boden gärtnern. Sondern Hochbeete benutzen, wie die meisten Garteninitiativen es tun – und zwar mit guter Bioerde.
Ansonsten aber ist die Stadt längst ein gutes Umfeld zum Gemüseanbau. Der Feinstaub lässt sich abwaschen, und die Autoabgase werden schon auf den ersten Metern vom Straßenrand fraktioniert, das heißt die leichtflüchtigen Bestandteile steigen senkrecht auf, während die schweren Teilchen wie Dieselruß von Bäumen und Hecken weitgehend abgefangen werden. Viele Supermarktprodukte, die von Feldern neben der Autobahn stammen (und bei welchen Produkten weiß man das schon?) sind womöglich stärker kontaminiert; massiv gespritzte Früchte sowieso.
Und was die Artenvielfalt angeht, ist die Stadt inzwischen oft besser dran als das Land. „Das Bild von der ‚schlechten Stadt‘ und dem ‚guten Land‘ muss dringend revidiert werden“, fordert Professor Josef Reichholf, langjähriger Hauptkurator an der Zoologischen Staatssammlung München, der sich seit Jahren wissenschaftlich mit der Stadtnatur beschäftigt; „was den Einsatz von Giften, Überdüngung, Grund- und Abwasserbelastungen anbelangt, haben sich die Verhältnisse zwischen Stadt und Land in den letzten Jahrzehnten geradezu umgekehrt.“
Die Honigbienen beispielsweise leiden fast überall massiv unter dem flächendeckenden Pestizideinsatz und dem einseitigen Blütenangebot – ein paar Wochen lang Raps und Obstbaumblüte und dann kaum mehr etwas. In den Städten dagegen blüht den ganzen Sommer über immer etwas.
5. Wenn ein paar Leute in der Stadt Gemüse anbauen, ändert das nichts am Industriefraß und an der globalen Vorherrschaft der Saatgutkonzerne
Stimmt. Aber wenn niemand etwas tut, ändert sich noch weniger. Außerdem erschöpft sich bei den meisten Stadtgärtnern die politische Aktivität nicht im Salatpflanzen. Sie sind nicht nur Gärtner, sondern auch Verbraucher, Staatsbürger, Steuerzahler und Wähler, die in ihrem gesamten Verhalten politisch wirken.
Viele sind überdies bei Netzwerken wie Campact oder Attac aktiv, beteiligen sich an Demonstrationen oder Petitionen wie zur Saatgutfreiheit oder gegen Gentechnik in der Landwirtschaft. Bei der großen Demo für eine andere Agrarpolitik am 21. Januar 2012 in Berlin unter dem Motto „Wir haben es satt!“ sind viele Mitglieder von Garteninitiativen selbstverständlich mit von der Partie.
6. Das Selbstgärtnern ist doch romantisches Getue. Wenn die Städte wirklich produktiver werden sollen, brauchen wir High-Tech-Farmen
Stimmt zum Teil. High-Tech-Gewächshäuser wird es künftig zunehmend geben – wenn auch nicht unbedingt die 30-stöckigen „Framscrapers“ die Dickson Despommier, ein Professor der Columbia-Universität, mit seinen Studenten entwirft. Aber grundsätzlich wird die Stadt als Produktionsstandort wegen der Nähe zum Verbraucher um so attraktiver, je stärker bei den Lebensmitteln die Transportkosten zu Buche schlagen.
Und deshalb wird es sicherlich große Gewächshäuser geben, regelrechte Gemüsefabriken, die mit ihrem effektiven Wasser- und Energieeinsatz punkten werden. Das private Gärtnern wird aber aus den oben angeführten Gründen – Selbstbestimmung, Bewusstseinsbildung, Kompetenzerwerb, sozialer Aspekt – daneben mit Sicherheit bestehen bleiben.